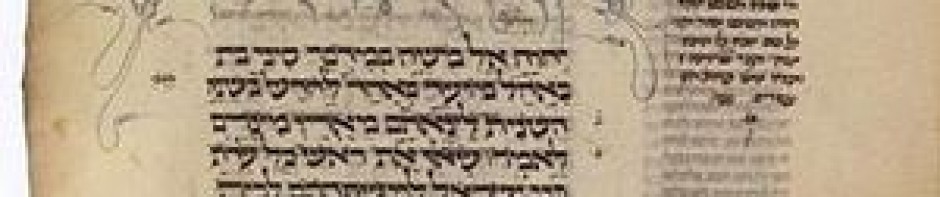In dem 1978 erschienen Nachfolgeband zur Tante Jolesch hat Friedrich Torberg, der ein begeisterter Wasserballer war, ein Kapitel über den Sport (Lieben Sie Sport?) aufgenommen, aus dem ich zwei Abschnitte zitieren möchte. Im ersten Abschnitt bringt Torberg folgende Anekdote über einen seiner Freunde:
„Es war die Geschichte, in der mein Freund Ernst Stern, Erkenntnistheoretiker und Ringkämpfer, eine unabwendbar scheinende Niederlage im letzten Augenblick in einen sensationellen Sieg verkehrt hatte und hernach von einem der ihn umdrängenden Journalisten gefragt wurde, was er sich denn in jenen bedrohlichen Sekunden, als er fast schon auf beiden Schultern lag, gedacht habe. Er antwortete: „Da hab ich mir gedacht. Ein Jud gehört ins Kaffeehaus.“
Der ironische Witz dieser Antwort bestand darin, dass ein Ringkämpfer, also der Inbegriff körperlicher Tüchtigkeit, sich mit dem Gegenteil solchen Inbegriffs, nämlich mit einem Kaffeehausbesucher, gleichsetzen konnte – und Ernst Stern war ja tatsächlich beides. Aber der Witz reichte noch ein wenig tiefer. Er entlarvte zugleich das damals noch sehr populäre (und zum Teil von den Betroffenen selbst popularisierte) Klischee, das den Juden als eine körperlich minderwertige, feige, wasserscheue und zu irgendwelcher physischen Leistung völlig untaugliche Figur hinstellte. Dieses vulgärantisemitische Klischee via facti zu dementieren, war einer der Hauptantriebe der jüdischen Sportbewegung (und der Grund, warum ich mich ihr angeschlossen habe). Heute wird das Dementi vom Staat Israel und seiner Armee besorgt, aber damals bot der Sport die einzige Möglichkeit dazu. Sie wurde lebhaft praktiziert. Das jüdische Bürgertum der Zwischenkriegszeit – und erst recht das in Wien massenhaft vorhandene jüdische Proletariat – haben am Sport begeistert Anteil genommen, und keinen bloß passiven im Zuschauerraum oder in Funktionärsstellungen (das unübertroffene Fußball „Wunderteam“ Österreichs war eine Schöpfung des jüdischen Verbandkapitäns Hugo Meisl), sondern aktiven und höchst erfolgreichen Anteil. Der jüdische Allround-Sportklub „Hakoah“ exzellierte in nahezu allen Sportzweigen, seine Faßballer gewannen 1925 die österreichische Meisterschaft, seine Ringkämpfer gewannen sie jahrelang hintereinander, seine Schwimmer und Wasserballer ebenso, und nebenan in Prag und Preßburg taten es ihnen die jüdischen Sportvereine „Hagibor“ und „Bar Kochba“ jahrelang gleich.
Der Vollständigkeit halber sei vermerkt, dass auch Deutschland eine Reihe jüdischer Spitzensportler besaß (die Fechtmeisterin Helene Mayer, den Eishockeystar Rudi Ball, den Sieger vieler internationaler Tennisturniere Daniel Prenn) und dass die führenden ungarischen Fußballmannschaften sich zu einem guten Drittel auf jüdische Spieler stützten. Und der Ruhmredigkeit halber sei hinzugefügt, dass Anfang der Dreißigerjahre von den damals offiziellen acht Gewichtsklassen im Boxen nicht weniger als fünf mit jüdischen Weltmeistern besetzt waren: Young Perez im Bantamgewicht, Bennie Leonard im Leichtgewicht und Weltergewicht, Maxie Rosenblum im Halbschwergewicht und der Schmeling-Bezwinger Max Beer, zugleich Weltmeister aller Klassen, im Schwergewicht. “ (S. 125-126)
„Es war die Zeit, als mein Klub, die Hakoah, sich den Aufstieg aus der zweiten in die erste Spielklasse erkämpfte und auf dem Weg dorthin auch an allerlei wüste Vorstadtmannschaften geriet, die sich gegen den jüdischen Gegner ganz besonders energisch, ja man darf ruhig sagen: brutal ins Zeug legten. Nicht nur auf dem Spielfeld und nicht nur im Zuschauerraum wußten die Rowdies – im Fachjargon „Pülcher“ geheißen – dafür zu sorgen, dass es mitunter lebensgefährlich zuging, auch hinter den Kulissen ließ man nichts unversucht, um die mißliebigen Siegesanwärter zu blockieren.
Wieder einmal hatte die Hakoah unter derart bedrohlichen Umständen anzutreten, gegen eine selbst für unterklassige Verhältnisse besonders derbe Mannschaft, auf einem graslosen, holprigen schotterhaltigen Spielfeld, einer sogenannten „G´stetten“. In diesem Match sollte sie durch einen aus Budapest herübergeholten Stürmer verstärkt werden, aber es war nicht sicher, ob die Formalitäten des Übertritts von einem Verband zum anderen rechtzeitig erledigt werden könnten und ob der neue Mann spielberechtigt wäre. In der Hoffnung, Endgültiges über seine Mitwirkung zu erfahren, trieb ich mich im Kabinengeviert herum und gelangte in Hörweite eines Gesprächs, das der Schiedsrichter mit einem Funktionär des gegnerischen Vereins führte. Der Schiedsrichter war zweifelsfrei als solcher kenntlich, und dass der Funktionär nur dem gegnerischen Verein angehören konnte, unterlag gleichfalls keinem Zweifel (denn die eigenen Funktionäre, die man natürlich kannte, sahen anders aus). Das Gespräch hatte allem Anschein nach ergeben, dass der Ungar trotz ungeklärter Sachlage spielen würde, und was der Funktionär jetzt äußerte, bildete unverkennbar den Abschluss: „I sag Ihna wos. Mir treten unter Potest an, Wann mir g´winnen, is eh guat. Und wanns die Juden g´winnen, gilt´s nix.“
Es will mir scheinen, als hätte dieser Ausspruch die Situation des Staates Israel um Jahrzehnte vorweggenommen.“ (S. 133-134)